Der 1. Odenwälder Apfelgipfel
Der 1. Odenwälder Apfelgipfel begann, thematisch passend, vor den Toren unseres Museums – wo die Mitglieder des Chors HuMor frischen Apfelsaft für unsere Gäste pressten. Moderatorin Friederike Kroitzsch stellt kurz das Programm vor und Bürgermeister Thorsten Weber blickt auf die erste Hälfte des 50jährigen Jubiläums der Gemeinde Limbach zurück und präsentiert die restlichen Highlights des Jahres vor. Und bevor es danach oben im Museum mit den ersten Gästen weitergeht, blickt Kay Vonderlage noch einmal tief in die „Seele des Odenwälders“, einem hundert Jahre alten Text voller Einsichten und Überraschungen …
Die sieben Teile und Themen

MuWa – 1. Odenwälder Apfelgipfel

Geschafft! Nach Wochen intensiver Vorbereitung haben wir den 1.Odenwälder Apfelgipfel erfolgreich zu Ende gebracht. Nochmals vielen Dank an unsere Gäste, die vielen fleißigen Helfer im Hintergrund und alle, die zugeschaut haben: Mehr darüber in den nächsten Tagen …

Ein gemeinsames Anliegen der Glorreichen Sieben ist die Pflege der Streuobstwiesen, ein Schwerpunkt des Limbacher Jubiläumsjahres, eng vernetzt mit zahlreichen lokalen Partnern.
Apfel-Akademie mit Rainer Schmitt
Obstbäume müssen gepflegt und regelmäßig geschnitten werden, damit man sich über ihren Ertrag freuen kann. Rainer Schmitt aus Wagenschwend ist einer, der weiß, was beim Baumschnitt zu tun ist. Er hat er sich bereit erklärt, im Rahmen unseres Jubiläums sein Wissen mit Bürgerinnen und Bürgern in einem kleinen Schnittkurs zu teilen. Baumschnitt als Bürgeraktion!
Apfel-Akademie mit Elmar Haaf
Streuobstwiesen prägen unsere Landschaft, sind als immaterielles Kulturgut anerkannt, ökologische Hotspots und Wirtschaftsfaktor. Und sind dennoch bedroht. Und sie bedürfen der Pflege. Wir haben frn Herrn über zahlreiche Apfelbäume in Wagenschwend, Elmar Haaf, beim Obstbaumschnitt über die Schulter geschaut: Spannend!
Baden-Württemberg ist Streuobstland
Förderung der Streuobstkultur
Die Landeskampagne soll die Etablierung einer Streuobstkultur auch in Kooperation mit den Kommunen, Biosphärengebieten, Naturparks, Landschaftserhaltungsverbänden, und LEADER-Regionen befördern. Bei Events, Festen und Veranstaltungen wie bei den Landesgartenschauen und Messen setzt sich das Land im Rahmen seiner Möglichkeiten für ein Angebot und die Präsentation von Streuobstprodukten ein. Streuobstveranstaltungen, Workshops, Fachkongresse, Forschungskolloquien und der grenzübergreifende fachliche
Austausch sollen verstärkt umgesetzt werden. Bewährte Öffentlichkeitsinstrumente, wie der Streuobstpreis Baden-Württemberg, der alle zwei Jahre ausgelobt wird, sowie die Unterstützung der Verleihung der Eduard-Lucas-Medaille und das Streuobst-Jahresgespräch mit den Verbänden sollen fortgeführt werden.
Ökowertpapiere
Wir wollen die Etablierung von Ökowertpapieren vorantreiben, um den Streuobstbau zu fördern. Streuobstgenussscheine können als zivilgesellschaftliches Förderinstrument zum Erhalt, zur Pflege und zur Neuanlage von Streuobstbäumen in Baden-Württemberg beitragen. Durch das finanzielle Engagement von Unternehmen und Bürgern sowie das ehrenamtliche Wirken einer Vielzahl von Akteuren wird die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen aktiv unterstützt. Streuobstbestände können zur Kohlenstoffbindung beitragen. Daher wollen wir Streuobstmaßnahmen prüfen, die geeignet sind, diese Senkenfunktion zu erbringen.
Ein landesweit einsetzbares Streuobstmobil soll als flexible und mobile Lern-, Wissens-, Erlebnis- und Genussstätte angeschafft und in Betrieb genommen werden.
Bildung
Streuobstbau findet generationsübergreifend statt. Er kann nur dann zukunftsfähig aufrechterhalten werden, wenn intensiv in die Bildungs- und Wissensvermittlung investiert wird. Wir wollen Streuobst verstärkt im Bildungsbereich verankern. Die Vernetzung von Lehrerinnen und Lehrern bzw. pädagogischen Fachkräften mit Streuobstakteuren wird aktiv angestrebt, um Streuobstthemen auch im Schulunterricht und im Kindergartenalltag zu etablieren.
Wir wollen zukünftig einen Zuschuss des Landes gewähren, damit vermehrt Lerneinheiten der Streuobstpädagogik für Schulklassen angeboten und umgesetzt werden.
Neben der Unterstützung der Streuobstpädagogik, dem Ausbau von „Lernorten Streuobstwiese“ und der Einrichtung von grünen Klassenzimmern, sollen die Vermittlung eines fachgerechten Baumschnitts sowie der Ausbau der Erwachsenenbildung vorangebracht werden. In den Bildungsangeboten des Landes sollen Streuobstthemen deshalb verstärkt angeboten werden.
Außerdem soll bei der Arbeit in den Naturpark-Kochschulen die Verarbeitung von Streuobst intensiver ins Blickfeld gerückt werden.
Quelle: Baden-Württemberg ist Streuobstland, Streuobstkonzeption Baden-Württemberg 2030
Moscht – 1000 Jahre Odenwälder Goldstandard

Apfelmost war ein wichtiges und ein gesundes Getränk auf jedem Bauernhof. Das Mostmachen, sammeln, keltern und ab ins Faß, hatte einen festen Platz im Bauernkalender. Traditionell: bereits vor fünftausend Jahren kelterten die Kelten Apfelwein. Sie wussten halt, was gut ist!
Der Most wurde selbst hergestellt, man brauchte lediglich ein paar Apfelbäume, eine Presse und ein Fass oder zwei. Getrunken wurde der Most, meist mit Wasser verdünnt, den ganzen Tag lang, insbesondere bei der Arbeit. Man schätzte, dass er Kraft gab. Das war bis in die Sechziger Jahre Goldstandard, bevor der eigene Apfelwein, de Moschd, in Vergessenheit geriet.

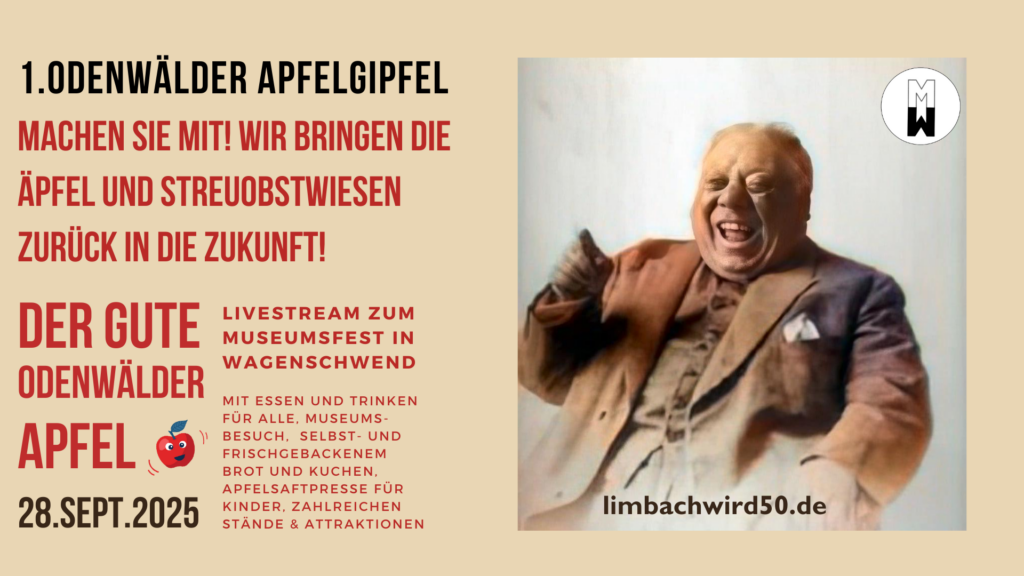
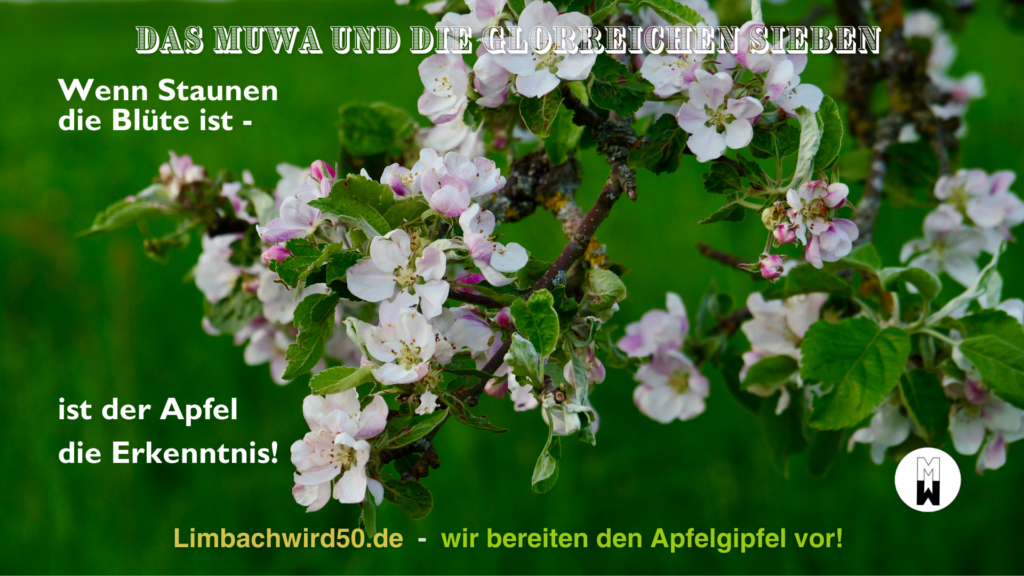
Kommt, von allerreifsten Früchten
mit Geschmack und Lust zu speisen!
Über Rosen läßt sich dichten,
in die Äpfel muß man beißen.
Johann Wolfgang von Goethe













